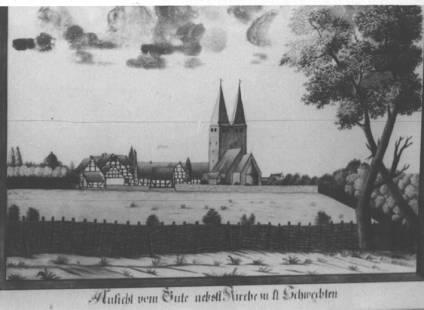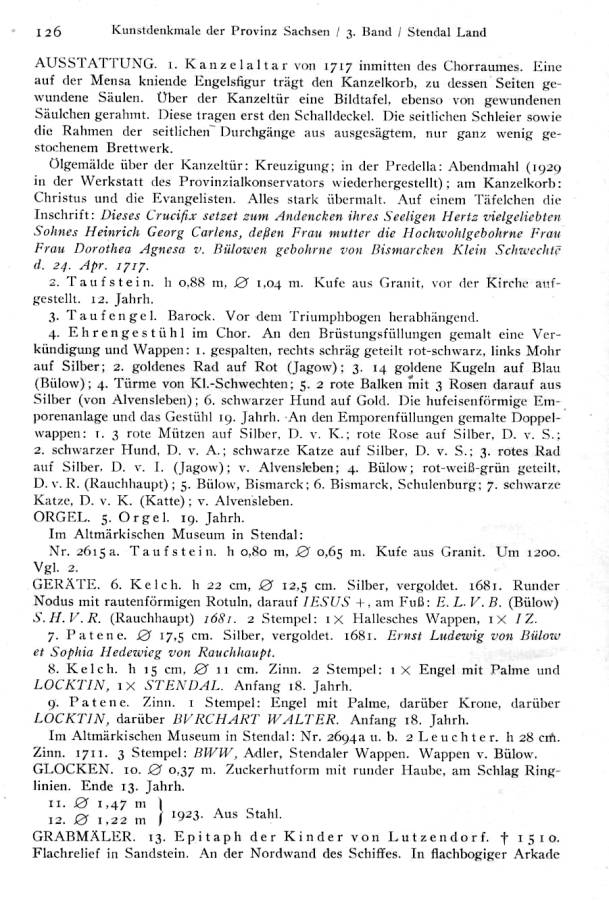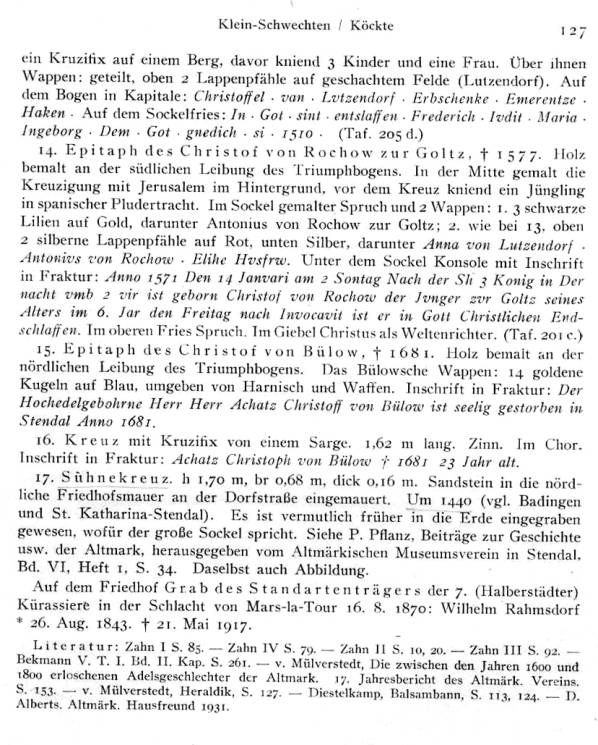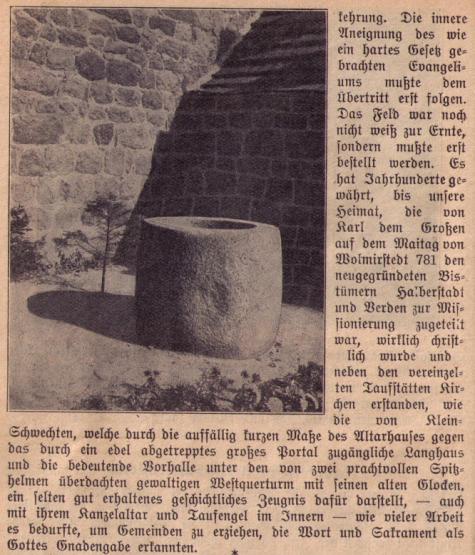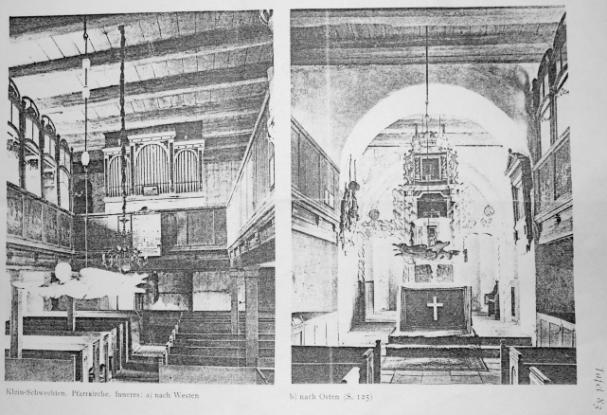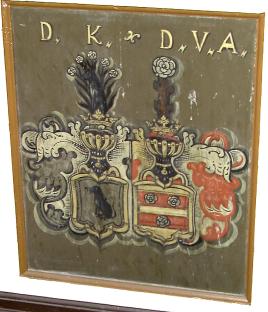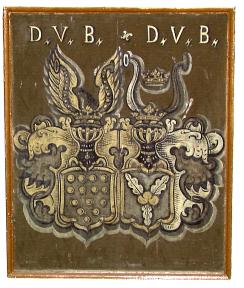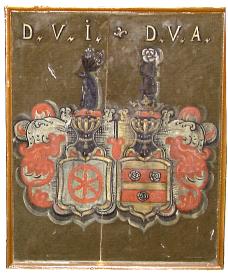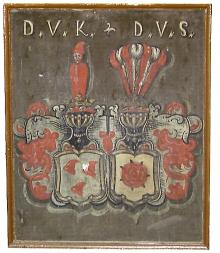|
Die
Kirche aus dem 11. oder 12. Jahrhundert |
||
|
von Christian Schröder, Isernhagen 2009, Die
nachstehenden Informationen basieren auch auf der Kirchenchronik sowie der
Gesamtchronologie (bis ca.1625) und der daraus noch fertig zu stellenden
Allgem. Geschichte von Klein Schwechten dieser Zeit. |
||
|
|
||
|
Die erste urkundlich belegte Nennung des Namens
„Schwechten“ ist von 1200. 1209 ist „Grotinswachten“, also Groß-Schwechten belegt,
also wird es auch ein
„klein-Schwechten“ gegeben haben, sonst macht das keinen Sinn. Es existiert
eine sehr umfangreiche Kirchenchronik von 1890, die auf noch ältere
Unterlagen zurück geht. Sie enthält ausführliche Informationen über die
Kirche, die Pastoren, die Küsterei, die Einkünfte der Kirche, ebenso die zur
Parochie gehörenden Kirchen in Möllendorf und Petersmark. Diese Chronik wird
dankenswerterweise ständig weiter gepflegt. Teile davon sind als Kopie im Besitz des Verfassers. |
||
|
|
||
|
Das älteste Gebäude im
Ort ist zweifellos die Kirche aus dem 12. Jhr. In „Kunstdenkmale der Provinz
Sachsen“ ist die Kirche ausführlich beschrieben, (siehe weiter unten). Nicht
alle Angaben sind dort auf dem neuesten Stand.
Ansicht der Kirche ca. 1860 mit Patronatsaufgang an der
Seite |
||
|
Die Kirche ist wie die
Friedhofsmauer aus Findlingen bzw. Feldsteinen gebaut. Da sie mit Sicherheit
früher als Wehrkirche diente, waren die Fensteröffnungen nur klein gehalten.
Erst bei der Wiederherstellung der Kirche 1857 - 1865 wurden die
Fenster erweitert. Genaueres ist evtl. aus den Kirchenbüchern zu entnehmen.
Neben den zwei Türmen gibt es eine weitere äußere Besonderheit, die nur noch
an einer weiteren von 250 Kirchen in der Altmark zu finden ist (Buchholz).
Die Kirche hat 12 Schallöffnungen. Die Zwölf ist eine besondere Zahl, sie
symbolisiert den geschlossenen Kreis.
|
||
|
Die weitere
Beschreibung s. ... Kunstdenkmale... auf den folgenden Seiten |
||
|
|
||
|
|
||
|
Ansicht
oben (2004) Eingang von Süden, Abb.rechts und unten links Turm von der
Westseite mit erhöht liegendem Zugang,
unten
rechts: Turm von Norden mit vermauerter Einstiegstür. |
||
|
|
||
|
Apsis an der Ostseite |
||
|
|
||
|
|
||
|
Abb. oben: Apsis an der Ostseite |
||
|
|
||
|
Der Grundriss zeigt einen vierteiligen Aufbau aus Turm, Schiff, Chor
und Apsis. Im Untergeschoß des Querturmes befindet sich ein Gruftgewölbe mit
früher z.T. vermauerten Gruften. In der Südwand des Schiffes befindet sich
ein rundbogiges Portal mit abgetrepptem Granitgewände und 2 alten
Rundbogenfenstern über dem Dach der stattlichen Vorhalle, die ein gleiches
Rundbogenportal hat. Das Mauerwerk dieser Vorhalle besteht ebenfalls aus
Findlingen, darüber ein gotischer Backsteingiebel mit Spitzbogenblenden und
Öffnungen (12. Jahrhundert). Auf der Nordseite vermauertes Spitzbogenportal
mit Granitgewänden. In der Apsis ist das alte Ostfenster mit rundbogigem
Granitgestein erhalten. In der Apsiskuppel sind 1932 romanische
Wandmalereien freigelegt worden. Sie stellen Christus als Weltenrichter in
der spitzovalen Mandorla dar. Rechts und links stehen als Fürbitter Maria und
Johannes. (Abbildungen weiter unten) |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
An Grabmälern sind zu
nennen: |
||
|
A.) Epitaph der Kinder von Lützendorf (Abb. unten) Auf dem Sockelfries: In•Got•sind entslaffen• Frederich, Ivdit•Maria•Ingeborg• Dem • Got•gnedich•si•1570•
|
||
|
Ganz offensichtlich sind hier 4 Angehörige innerhalb kurzer Zeit verstorben. Aus ständiger Überlieferung ist bekannt, dass es sich um Kinder handelt, jedoch ist die Person rechts ganz offensictlich Größer, evt. eine Erwachsene Person. An verschiedenen Stellen in der Literatur wird das Datum fälschlich mit 1510 statt 1570 angegeben. Das kann nicht sein da Christoffel v.L. damals noch nicht lebte. |
||
|
B.) Epitaph des Christof von Rochow zur Goltz ‡1577, befindet
sich an der südlichen Laibung des Triumphbogens. In der Mitte gemalt die
Kreuzigung mit Jerusalem im Hintergrund, vor dem Kreuz kniend ein Jüngling in
spanischer Pludertracht. Im Sockel gemalter Spruch und 2 Wappen:
|
||
|
|
||
|
C.) Kreuz mit einem Kruzifix von einem
Sarge 1,62 m lang aus Zinn, im Chor, mit der Inschrift in Fraktur: Achatz
Christph vom Bülow ‡1681, 23 Jahr alt. ohne Abbildung |
||
|
D.) Epitaph
des Achatz Christof von Bülow,
‡1681,
|
||
|
E.) Sühnekreuz in der
Friedhofsmauer
F.) Grabmahl des
Standartenträgers der 7. (Halberstädter) Kürassiere in der Schlacht von Mars-la-Tour
16.8.1870:
Abb
rechts aus dem Jahr 2009 nach der Restaurierung früher
soll sich noch ein Adler aus Eisen darauf befunden haben |
||
InnenausstattungRomanische Wandmalerei im Apsisbogen
|
||
|
Romanische Wandmalerei im
Apsisbogen
In der Apsis auf der Ostseite |
||
|
Auf dem Sockel in der Apsis:
Martyrium des Hl. Laurentius
Auf dem Sockel in der Apsis:
Martyrium des Hl. Laurentius
Auf dem Sockel in der Apsis:
Martyrium des Hl. Laurentius
|
||
|
Blick in den Altarraum von der
Empore aus. links die Plätze für den Pfarrer, rechts die Patronatsloge.
Wappen beidseitig der Kanzel links v. Bülow, rechts v. Bismarck |
||
|
Beachtenswert ist das Ehrengestühl
im Chor für den Kirchenpatron (rechts vom Altar, Abb oben rechts ) und den
Pastor (links vom Altar, Abb.oben links). An den Brüstungsfüllungen sind
gemalt:
Ehrengestühl für den Kirchenpatron |
||
|
Die Orgel auf der Empore (2008)
Der aus einem Gramitblock gehauene
Taufstein war früher vor der Kirche aufgestellt.. |
||
|
Altmärkischer Hausfreund v. 1931 |
||
|
Innenraum
Alte Ansicht vom Altar nach
Westen. Die Empore war früher verkleidet und mit Fenstern versehen.Darunter
die nachstehend erläuterten Wappen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Teil
der Empore für die Familie des Kirchenpatrons und Gutsbesitzers vorgesehen
war. |
||
|
Wappen an der Brüstung
der Empore im Kirchenschiff
V. Katte – v. Alvensleben evtl.
v.d.Asseburg? - ?
V. Bülow – v. Bismarck v.
Bülow – v. Rauchhaupt
v. Bismarck – v.d.Schulenburg V.
Jagow – v.Alensleben
Die
Wappen sind immer doppelt angelegt und stehen für die jeweiligen
Eheschließungen der Geschlechter. Sie stammen alle aus der bülowschen
Zeit, also etwa ab 1625, wobei wahrscheinlich die Familie erst ab ca 1650
nach Klein Schwechten gezogen ist. Karstedt
– v. Saldern |
||
|
Vorhalle an der Südseite
Gedenktafeln in der Vorhalle
Dem Andenken der Gefallenen des 2.
Weltkriegs. |
||
|
Aus der Kirchenchronik Im
Sommer 1963 wurden beide Kirchtürme neu mit Schiefer eingedeckt. Dabei
wurde die südliche Turmkugel geöffnet. Sie enthielt eine Kupferkapsel mit
alten Dokumenten, Zeitungen und Münzen. In die Kugel wurde ein neues
Schreiben gelegt (Wortlaut in der Kirchenchronik von Pastor Blümner), eine
Tageszeitung und 3 Münzen. Aus der Kirchenchronik geht hervor, dass seit 1902
keine Schriftstücke mehr in die Turmkugeln gelegt worden sind. Für die
Neudeckung der Türme wurden in Klein Schwechten fast 10.000 Mark gespendet,
7000 Mark kamen vom Konsistorium Magdeburg. Seit dieser Zeit ist das Gewölbe
im Turmraum mit zum Kirchenraum dazu genommen. Es wurde nachträglich
gepflastert. Verschiedene weitere Ausstattungsgegenstände sollen sich im
Altmärkischen Museum in Stendal befinden bzw. befunden haben, so auch der
Taufstein aus Granit aus dem 12. Jahrhundert. 1965 wurde der große
Taufstein wieder in der Kirche aufgestellt. Er wurde dazu verändert, man hat
einen Teil des Sockels abgeschlagen (weitere Fotos s. Kirchenchronik)
|
||
|
Bei
Mauerarbeiten gab es eine Entdeckung: rechts neben dem Altar war eine
Fußbodenfliese etwas abgesackt. Darunter befand sich ein faustgroßes Loch. Es
wurde noch ein Stein entfernt und darunter zeigte sich ein zusätzlicher Raum,
der etwa 3,5 Meter lang und 2 Meter breit und 1,80 Meter tief war. In diesem
Raum lagen etwa 7 -10 Gerippe, dazwischen verkohlte Holzreste von Särgen. Er
ist weiß getüncht und die Wände sind zum Teil mit Bibelsprüchen versehen. Der
Denkmalpfleger stellte fest, dass die Bestattung im 16. oder 17. Jahrhundert
stattgefunden haben muss. Der Raum wurde wieder verschlossen und ist seitdem
nicht wieder geöffnet worden. (s. Kirchenchronik, auch mit Fotos). Bei
der Innenrenovierung der Kirche 1963 wurden auch zwei beinahe vergessene
Grabkammern geöffnet. Das eine Gewölbe, hinter einer Holztür an der Rückwand
des Kirchenschiffs gelegen, war seit 1880 nicht mehr geöffnet worden. Es
enthielt 9 gut erhaltene Särge. der letzte war 1880 hereingebracht worden.
Außerdem waren 1920 zwei Urnen in einen Lichtschacht geschoben worden, der
dann von außen zugemauert worden war. All diese Särge und Urnen wurden 1965
auf dem Friedhof bestattet, südlich der Kirche in einer großen Grube. (s.
Abb. u.) Die Särge
waren beschildert und daher ließ sich feststellen, wer dort bestattet war: mit
Kreide auf beiden Särgen: “von Steinersdorf” (Verwandtschaft zu v.
Rauchhaupt) ‡
1.10.1920. Es
handelt sich hier um die Familien der ehemaligen Gutsbesitzer und Patrone
bzw. naher Angehöriger. |
||
|
Diese
Särge wurden aus dem Gruftgewölbe entnommen und an der Westseite des
Friedhofs beigesetzt. |
||
|
Sitzordnung in der Kirche
In der
Kirche selbst gab es eine Sitzordnung, an die man sich tunlichst zu halten
hatte. Wie diese
Sitzordnung entstanden ist läßt sich nicht mehr rekonstruieren. Die Zahlen
entsprechen den Hofnummern |