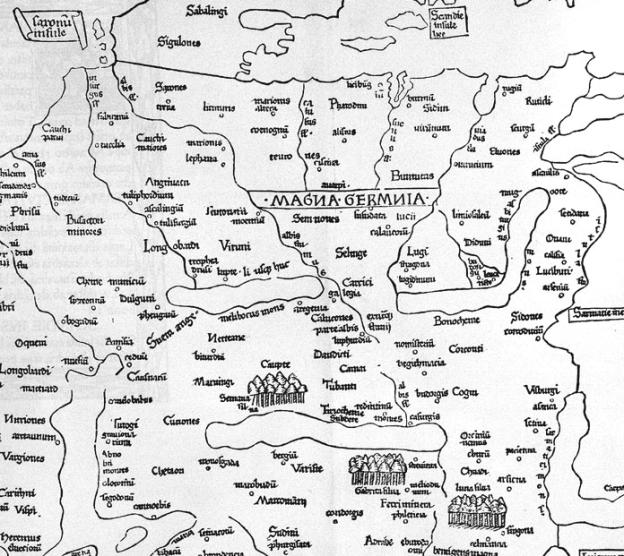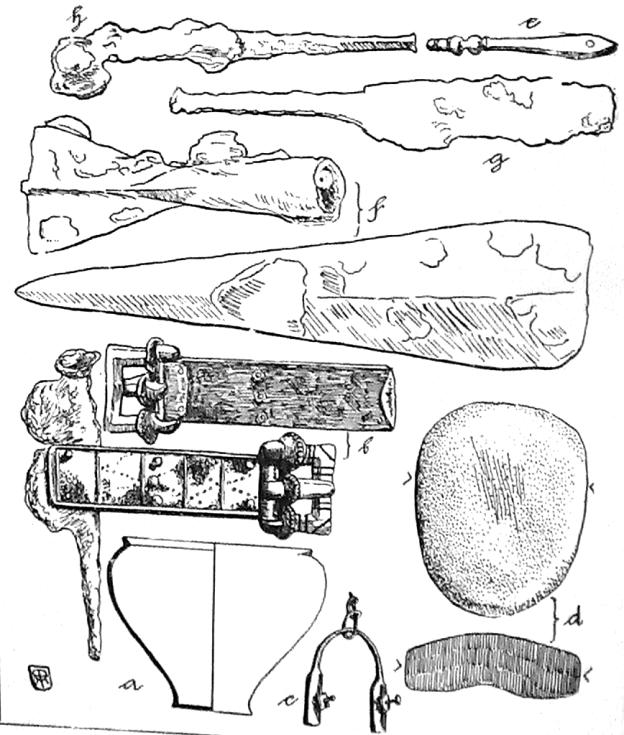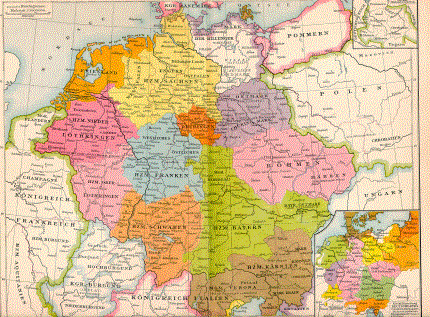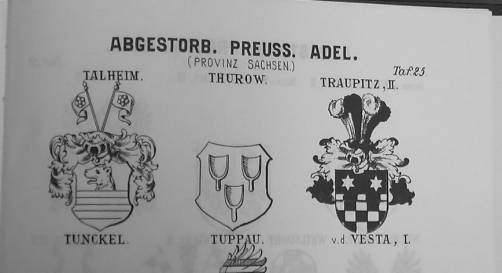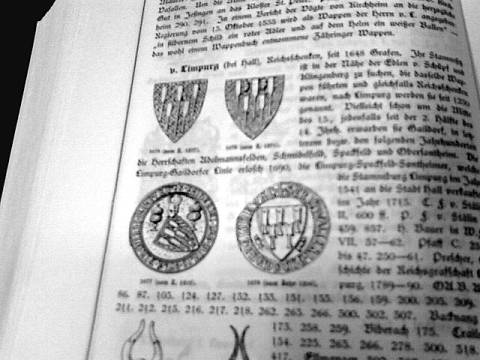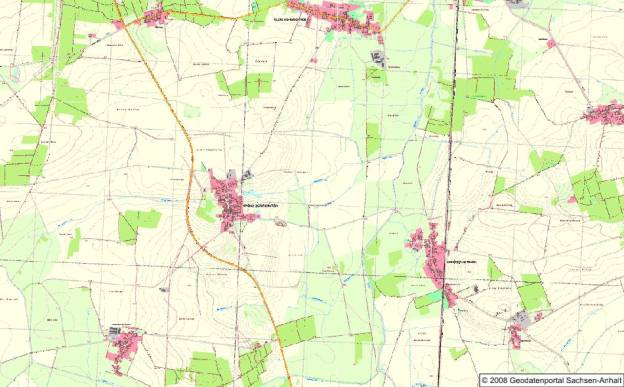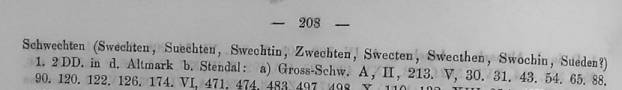|
Klein Schwechten in der
Altmark Bundesland:
Sachsen-Anhalt, Landkreis: Stendal, Verwaltungsgemeinschaft:
Arneburg-Goldbeck Höhe: 26 m ü. NN
Fläche: 18,91 km² (incl. Ortsteile) Einwohner: 535 (31. Dez. 2006) Bevölkerungsdichte: 28 Einwohner je km2 |
|
|
|
Luftaufnahme von Klein
Schwechten und die aktuellen Gemarkungsgrenzen (2007) |
|
Entstehungsgeschichte und Besiedlung Das genaue Entstehungsjahr des Ortes ist
bisher nicht weiter bekannt. Es wird auch in dieser bestimmten Form nicht
möglich sein ein Gründungsjahr festzulegen, denn von einer „Grundsteinlegung“
im heutigen Sinn kann man sicherlich nicht ausgehen, obwohl es im Mittelalter
auch vorgekommen ist, dass gezielt Siedler ab einem bestimmten Stichtag
angesetzt wurden und manchmal gab es auch Urkunden, in denen Lokatoren mit
der Besiedlung eines Gebietes beauftragt wurden (z.B.im codex diplomaticus
anhaltinus CDA 1, 2, 1159, lfd. Nr. 449 zum Dorf Pechau oder Nr. 450 zu
Wusterwitz aus dem Jahr 1159). Zu Klein Schwechten oder Groß Schwechten habe ich
bisher nichts Vergleichbares gefunden. Man kann also nur versuchen aus den
wenigen vorhandenen, meist unsicheren Quellen gewisse Rückschlüsse zu ziehen. |
|
Münzfunde aus der
röm. Kaiserzeit (ca. 1- 375 n.Chr.) Zahlreiche Grabungsfunde u.a. aus spätrömischer Zeit sind hier in der
unmittelbaren Umgebung gemacht worden. Dokumentiert sind u.a. insgesamt 18 Münzfunde in der Gemarkung
Klein Schwechten aus der Römischen Kaiserzeit, die alle Im LMV Halle
aufbewahrt werden. Diese Münzen entstammen einer kaiserzeitl. Siedlung mit
urgeschichtlicher Vorbelegung Fundzeit 1993, 1995, 1997 u.a. am südl. Feldweg
zwischen Groß Schwechten und Klein Schwechten. Archäologische Funde
aus dem 5.- 8. Jahrhundert Die Gegend hier war schon in frühester Zeit
besiedelt. In einer Veröffentlichung
des Altmärkischen Museumsvereins von 1916, Band IV, Heft 2 wird ausführlich
über die Entdeckung und Sicherung eines Grabes in Klein Schwechten in
den Waldstück „Vosskuhlen“ berichtet, das fränkisch-merowingische (frühes 5.-
Mitte 8. Jhr.) Ausstattungsgegenstände enthält.
Siedlungen der Langobarden
und anderer germanischer Völker im 3.-5. Jahrh.
Auch bei Groß
Schwechten wurden u.a. 1998 im Zuge des Baus der Umgehungsstrasse
(Bundesstrasse) Hinweise auf Siedlungen aus diesen Zeiten gefunden. Die
Grabungsbefunde haben ergeben, dass dort eine Siedlung bestand, die bis etwa bis
ins 5./6. Jahrhundert existierte und eine Ausdehnung über ca. 13 ha hatte. Im 5. und
6. Jahrhundert wurde das Gebiet der
Altmark im Zuge der Völkerwanderung weitgehend verlassen und dann
Mitte des 7. Jahrhunderts von slawischen/wendischen Einwohnern besiedelt.
Zumindest der erste Teil deckt sich mit den Grabungsbefunden aus dem Jahr
1998 in Groß Schwechten. Die Neubesiedlung
durch Slawen/Wenden erfolgte ab dem 7. Jhr. in der Altmark durch zwei
Stammesgruppen, nämlich einerseits aus Nordwesten, dem heutigen Wendland
durch die Drawäner und in der östlichen Altmark durch die Luitizen, die aus
südlicher Richtung gen Altmark zogen.
Westliche Slawensiedlungen
am Hoebeck |
|
Besiedlung ab Karl. d. Großen Nach der Eroberung des hiesigen Gebietes durch Karl den Großen um 780
nahm die germanische/ sächsiche Bevölkerung wieder zu ohne die slawischen
Einwohner komplett zu vertreiben. Unter Karl dem Großen erfolgte die
Einteilung der Bistumsgrenzen hier in der Altmark für das Bistum
Halberstadt und Verden, die im Prinzip bis zur Reformation bestehen blieb. Auch nach dem Slawenaufstand von 983 (u.a. Walsleben)
war die Altmark nicht komplett von den germanischen Einwohnern geräumt,
sondern es verschoben sich immer nur in gewissem Umfang die Gewichtungen der
Völker. Dabei kam es zu einer Mischung slawischer und germanischer Siedlungen
wobei oft, wenn vorhanden, der germanische oder slawische Ortsname
beibehalten wurde. |
|
|
|
Kirchliche Einteilung Deutschlands
vom 11.-16 Jahrhundert |
|
Schriftliche Quellen aus alter Zeit Der 5. Band des 1.
Hauptteils enthält wesentliche Urkunden zur Altmark |
|
|
Bei den
Recherchen ist aufgefallen, dass zu vielen Quellenangaben im CDB ein Hinweis
auf das Archiv des Geheimrat von Werdeck vorhanden ist. Dieser hat dem
Herausgeber A.F. Riedel wesentliche Quellen zu Klein Schwechten und den
Familien v. Lützendorf, von Vinzelberg und von Klö(ä)den geliefert und sich demnach
um 1830 auch schon mit dem gleichen Forschungsthema beschäftigt wie ich jetzt
(seit 1998). (Zur Erinnerung: Hans Gottlieb Freiherr von Werdeck kaufte das
Gut in Klein Schwechten im Jahr 1813). |
|
|
In der Gründungsurkunde der Kirche des Klosters Krevese
vom Jahr 1200 werden dieser Kirche verschiedene Einkünfte und Ländereien
zugewandt u.a. auch die Kirche in Schwechten (wohl Groß Schwechten, s.
Chronologie). Diese Einkommenssituation für Krevese hat sich lange erhalten
und änderte sich erst 1562 mit der Abtretung des Besitzes der Fam. von
Bismarck in Burgstall an den Kurfürsten und den Ersatz dafür, wobei auch
Krevese an die Familie von Bismarck fiel. Das Kloster Krevese selbst ist nach
der Überlieferung nach der Schlacht Albrecht des Bären um die Festung
Brandenburg 1157 zum Andenken an den dort gefallen Graf Werner IV. von
Osterburg (v. Veltheim) von seinem Vater Werner III. gegründet worden. (Albrecht
d.B. und von Osterburg/v. Veltheim waren verwandt, die Mutter des Werner IV
war eine Schwester von Albrecht d.B.) In das Jahr 1200 fällt demnach die älteste Erwähnung des
Namens Schwechten als Ortsbezeichnung. (Stand 2008). Die Unterscheidung
zwischen Klein und Groß Schwechten ist dann kurz darauf nämlich 1209
durch die Nennung von Grotinswachten“ nachgewiesen. Allerdings nur
durch den Umkehrschluß, denn wenn es die Notwendigkeit gab „Grotinswachten“
zu benennen muß es auch ein anderes, kleines „Swachten“ gegeben haben,
ansonsten wäre die gemachte Unterscheidung sinnlos. Klein Schwechten
ist also vermutlich älter als 1209, dem Jahr der erster Erwähnung des Namens
„Grotinswachten“ . Allerdings nehme ich an, dass diese unterscheidende
Benennung nicht lange nach der Ortsgründung gemacht wurde. |
|
|
Wenn man im Landbuch der Mark Brandenburg von 1375 die
beiden Orte Klein und Groß Schwechten vergleicht, fällt auf, dass in Klein
Schwechten eine geradezu übersichtliche Abgabenstruktur herrschte, während in
Groß Schwechten allein ca. 40 Bewohner namentlich genannt sind, die an viele
verschiedene Empfänger auch von außerhalb Abgaben zu leisten hatten. Das kann
in der Entwicklungsgeschichte des Ortes begründet liegen, ist aber nicht
belegt |
Deutschland
um 1378 zur Zeit Kaiser Karl IV. |
|
Wilhelm Zahn nennt in seinem Buch „Wüstungen der Altmark“: lfd.
Zitatende. Und auch für die
Umgebung von Groß Schwechten ist eine Wüstung verzeichnet mit Flurstücken,
die „Alte Dorfstücke“ heißen (s. Zahn, Wüstungen...) Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass in alten mündlichen Überlieferungen
immer wieder berichtet wurde, dass in der Feldmark zwischen Klein und Groß
Schwechten von Bauern beim Pflügen Steine (evtl. Fundamentpflaster) gefunden
sein sollen. Nun sind Steine in der Feldmark von Klein Schwechten sicherlich
nichts Besonderes, eher schon wenn man keine findet. Allerdings wären die
Geschichten nicht entstanden, hätte es sich nur um die üblichen Feldsteine
gehandelt. Es könnte sich also um Reste einer älteren Siedlung handeln (Siehe
oben Münzfunde). Es könnte z.B. sein, dass Siedler, die im 12. Jahrhundert aus
Holland, Flandern oder Westfalen ins Land geholt wurden, hier angesiedelt
wurden (verschiedene Namen im Landbuch v. 1375 aus Groß Schwechten haben
offensichtlich einen
holländisch-flandrischen Ursprung und könnten ein Hinweis sein. In
Holland hatten zu der Zeit viele Menschen unter Flutkatastrophen (1164 erste
Julianenflut, 1170 Allerheiligenflut, 1196 Nikolausflut) zu leiden und
könnten auswanderungswillig gewesen sein, zudem ist die Anwerbung und
Einwanderung dieser Menschen in der Zeit Albrecht des Bären belegt. Auch in
Klein Schwechten gab es beispielsweise den Familienanmen „Seeflut bzw.
Seefloth“, was auch nicht auf Binnenländer hindeutet). Auch aus
Flurbezeichnungen wie „Märsche“ lassen sich Hinweise auf Holländer ableiten.
Es sollte aber nicht nur auf Holland gesehen werden, sondern möglicherweise
auch auf andere Gebiete wie z.B. das heutige Westfalen. Mit Hilfe der
Siedler, woher auch immer sie kamen, wurden weitere Flächen nutzbar gemacht
und besiedelt. |
|
Kirchenbau als Hinweis auf die Entstehung
|
|
Die Kirche ist dem Heiligen Laurentius
geweiht (Die Legende erzählt: Als Archidiakon von Rom
war Laurentius in Vertretung des Papstes für die Verwaltung des örtlichen
Kirchenvermögens und seine Verwendung zu sozialen Zwecken zuständig. Nachdem
der römische Kaiser Valerian Papst Sixtus hatte enthaupten lassen, wurde
Laurentius aufgefordert, alles Eigentum der Kirche herauszugeben. Daraufhin
verteilte Laurentius das Vermögen an die Mitglieder der Gemeinde, versammelte
alle Armen und Kranken und präsentierte sie als den wahren Reichtum der
Kirche dem Kaiser. Dieser ließ Laurentius daraufhin mehrfach foltern und dann
durch Grillen auf einem eisernen Gitterrost qualvoll hinrichten. Der
Überlieferung nach waren seine an den Kaiser gerichteten letzten Worte: „Du armer
Mensch, mir ist dieses Feuer eine Kühle, dir aber bringt es ewige Pein.“) Etwa in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, entstand die Kirche.
Sie diente, wie damals üblich, auch als Wehrkirche und ist damit zweifellos
das älteste Gebäude im Ort. Ein wichtiger Punkt in der Zeitgeschichte ist also der Kirchenbau im
12. Jahrhundert, etwa zeitgleich mit dem Kirchenbau in Groß Schwechten, die
ebenfalls dem hl. Laurentius geweiht ist. Um 1200 sei die Kirche in Groß Schwechten unmittelbar nach Beendigung
der Bauarbeiten oder Restarbeiten an das Kloster Krevese übergeben worden (s.
Urkunde Bischof Gardolf, dieses ist belegt s. Chronologie) Da bei Milkowski oft Quellenangaben fehlen, sind seine Information
natürlich mit Skepsis zu betrachten bis die Daten belegt sind (Das gilt
für die gesamten geäußerten Schlüsse von Milkowski soweit sie nicht mit
Quellen belegt sind, da Milkowski die Geschichte sehr sozialistisch-politisch
geprägt betrachtet.). Trotzdem sollte den Hinweisen und angedeuteten
Quellen nachgegangen werden (evtl. Kirchenbücher v. Gross Schwechten) |
|
Ritter in Schwechten Ein Rittergut (lat.
praedium nobilium sive equestrium) war ursprünglich ein steuerfreies Landgut,
dessen Eigentümer Ritterdienste, also ursprünglich persönliche Leistungen
(Heerfolge), später auch Geldleistungen (Ritterpferdsgelder) leistete und
daher einige Vorrechte wie die der Steuerfreiheit genoss. Diese Vorrechte, deren
Besitz ursprünglich Ritterbürtigkeit bedingte, wurden mit der Zeit als
Zubehör der Rittergüter selbst angesehen (nobilitas realis). Zu ihnen
gehörten vor allem Befreiung von bäuerlichen und öffentlichen Lasten
(Steuern, Einquartierung, Fronen etc.), zu denen der Ritterdienst ehemals als
Äquivalent gegolten hatte, ferner Landstandschaft,
Patrimonialgerichtsbarkeit, Jagdgerechtigkeit, Fischerei, Baugerechtigkeit
und andere Bannrechte (Jagdrecht, Mühlenrecht, Braurecht usw.). Bis zum 18. Jahrhundert wurden diese Vorrechte beseitigt.
Während ursprünglich nur Adlige Rittergüter besitzen konnten, durften später
auch Bürgerliche dergleichen erwerben. Wegen der mit dem Gut verbundenen
Rechte war der Erwerb besonders interessant. In früherer Zeit wurden die Rittersitze am Rande des Ortes angelegt,
u.a. aus Sicherheitsgründen. So wohl auch in Klein Schwechten. Irgendwelche frühen, mittelalterlichen Hinweise (12.Jahrhundert) auf
ein Rittergut oder einen Ritter im Zusammenhang mit Klein Schwechten sind mir
bisher nicht bekannt geworden. Ebenso gibt es keinen Hinweis auf ein
Rittergut in Groß Schwechten zu dieser Zeit. Auch im Landbuch Karl IV. sind
für Klein Schwechten keine Ritter ausdrücklich genannt. Man kann allerdings
davon ausgehen, dass die aufgeführten 3 Höfe (Schenk, Vinzelberg, Kläden)
Rittersitze waren. |
|
1266 werden die
Ritter Konrad von Schwechten und Henning von Schwechten urkundlich in
einer pommerschen Urkunde erwähnt.
Seinerzeit hatten die von Schwechten in Groß Schwechten
-lt. Landbuch von 1375- 3 Höfe in der Größe von 4-Hufen, also ebenso groß wie
die Höfe der von Vinzelberg, von Kläden und Peter Schenk von Lützendorf in
Klein Schwechten, der noch 2 Hufen Eigengut hatte. Insgesamt hatte Klein
Schwechten 25 Hufen lt. Landbuch Karl IV. und Groß Schwechten ca. 55
Hufen. Mehr siehe Chronologie. |
|
|
|
|
|
3 Schaufeln im
Schild sind das Wappen des Ritters v. Schwechten (lt. Siebmachers Wappenbuch) Das Wappen der Ritter von Schwechten, drei Schaufeln, gibt nun Anlass
zu mancherlei Spekulation. Welchen Sinn haben die drei Schaufeln? Es sind
ganz offensichtlich die damals üblichen Schaufeln für das Scheffeln von Korn
oder ähnlichen Gütern. Sind sie ein Hinweis auf ein Amt oder auf einen
ertragreichen Besitz? Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Weitere
Recherchen könnten über den Ursprung des Namens geführt werden oder auch über
das Wappen selbst, s.u.. |
Ein fast identisches Wappen finden wie ebenfalls bei
Siebmacher zu dem Namen „Thurow“ aus dem Fürstentum Anhalt. Dazu und zu
möglichen Verbindungen zu Schwechten gibt es noch keine Erklärung.
Ein gleiches Wappen führte
Melchior von Meckau. Melchior von Meckau (auch Meggau) (* um 1440; †
3. März 1509 in Rom) war Dompropst in Meißen, Fürstbischof von Brixen (1488
bis 1509) sowie Kardinal. Die Abbildung an der
Dompropstei in Meißen (siehe rechts) zeigt das Familienwappen des
Fürstbischofs mit den drei
aufrechten goldenen Mehlschaufeln im roten Feld, das Wappen des Bistums von
Brixen mit dem siegreichen Osterlamm im roten Feld (links) und des Bistums
von Meißen Die Schaufeln im Wappen
führten ebenfalls die Schenken v. Limburg . |
|
Jetzt bleibt für Gedankenspiele
allerlei Spielraum: Es könnte z.B. sein, dass am Ort der
Münzfunde zwischen Klein Schwechten und Groß Schwechten eine
vorgeschichtliche Siedlung war, dann eine Siedlung aus der Römischen
Kaiserzeit und anschließende hier eine slawische Siedlung und darum verstreut
einzelne Gehöfte aus der Zeit der ersten slawischen Besiedlung der Altmark im
7./8. Jahrh. ist. Diese hat sich dann mit gemischter Bevölkerung erhalten.
Dazu paßt auch die von W. Zahn angegebene Wüstung in der Flur Klein
Schwechten. Sicherlich
gibt es gewisse Parallelen mit der Entstehung von Groß Schwechten. Hier
sollte weiter recherchiert werden. |
|
Also spekulieren wir einmal: Klein
Schwechten ist wahrscheinlich mehr wendischen Ursprungs als eine germanische/sächsiche
Siedlung. Dies trifft eher auf den Nachbarort Groß Schwechten zu. In der
Regel war es so, dass germanische /sächsische Siedlungen im altmärkischen
Raum, den Zusatz „Groß“ erhielten und die Siedlungen mit
wendischem/slawischem Ursprung mit „Klein“ als Zusatz versehen wurden. Da
dies als Unterscheidungsmittel diente, bedeutete es, dass gleichzeitig
Siedlungen wendischen wie auch germanischen Ursprungs existierten. Klein
Schwechten könnte auch eine Aussiedlung/Ortsteilung oder Umsiedelung
von Groß Schwechten ausgehend sein z.B. aus dem 8./9. Jahrhundert, wobei eine
ältere slawische Siedlung einbezogen wurde und der slawische Name dabei
untergegangen ist. Mir erscheint
folgende Lösung sehr wahrscheinlich: Bei
Neusiedlungen oder Umsiedlungen übernahmen oft Lokatoren (i.d.R.
Ritter, Ministeriale, Edelleute, also freie oder unfreie Vasallen des
Landesherrn) die Aufgabe, Siedler anzuwerben, das Land zu vermessen in Felder
und Hufen (Verhufung) einzuteilen und an Bauern zu vergeben. Die Lokatoren
nahmen meist selbst größere Höfe für sich und meist gab es einen Freihof für
den Schulzen im Ort. Evtl.
wurde also das alte „Stammdorf“ geteilt oder zwei Siedlungen neu angelegt und
dabei alte, kleine, verstreut liegende Siedlungsinseln mit einbezogen, bzw.
deren Bewohner wurden im neuen Ort angesiedelt. Diese Lösung,
also das Zusammenziehen verschiedener kleinerer Siedlungsinseln zu einem Ort
machte durchaus Sinn. Es wurden überschaubare Siedlungen geschaffen, diese
bekamen einen Verantwortlichen (Ritter, Dorfschulze), es wurde eine
strukturierte Feldflur (Gewanne) geschaffen, was für die 3-Felder-Wirtschaft
wichtig war, dadurch bessere
Einnahmen, Kirchenbau, dadurch Stärkung der Kirchenrechte, -einnahmen (Zehnt),
besserer Schutz etc.. Also alles in Allem etliche Vorteile. Für die
Landesherrschaft (Markgrafen) hatte dies den Vorteil, dass praktisch alle
Rechte in diesem Dorf bei ihm lagen, alle Höfe nur zu (wenn auch erblichen)
Lehen vergeben waren und im Erbfall auch anderweitig zu vergeben waren. Dies
erscheint gerade bei Klein Schwechten gut nachvollziehbar, denn in Groß
Schwechten waren offensichtlich schon sehr stark gewachsene Rechte- und
Abgabenstrukturen entstanden, die in Klein Schwechten sich ganz anders
darstellten. Zudem paßt diese Vorgehensweise zu dem damaligen Bestreben des
Markgrafen das Gebiet der späteren Altmark mehr unter seine Kontrolle und
Verfügungsgewalt zu bekommen. Wahrscheinlich
kamen in diesem Zusammenhang auch neue Siedler ins Dorf. Dabei wurde evtl.
der Flußlauf der Uchte verändert um mehr Land zur Bewirtschaftung zu gewinnen
(Ein Hinweis auf diese Veränderung könnte sein, dass es einzelne, zu Klein
Schwechten gehörene Flurstücke jenseits der Uchte auf Goldbecker Seite gibt
und umgekehrt. Ich komme später bei den Flurbezeichnungen noch einmal darauf
zurück, z.B. die Märsche, die einen Hinweis auf nasses Wiesengelände und auf
die niederländische Sprache geben.). Auch in Groß
Schwechten könnte gleichzeitig diese Art der „Flurbereinigung“ abgelaufen
sein. Anschließend, also etwa ab 1150
erhielten die beiden neuen Dörfer jeweils eine eigene Kirche, die beide
dem Hl. Laurentius geweiht wurden.
Sicherlich auch ein Hinweis auf Gemeinsamkeiten. Wenn man die
Idee einer zusammenfassenden Neusiedlung
einmal theoretisch weiterdenkt, könnte es so sein, dass in Klein
Schwechten überwiegend wendischstämmige Einwohner aus dem Altort oder
umliegenden Kleinsiedlungen angesiedelt wurden. Evtl. waren die größeren
Bauern (die später so genannten Ackerleute) deutsche oder holländische Siedler
und die Wenden waren überwiegend die Kossaten, Einlieger und Häusler. Die evtl. 3
Lokatoren (von Vinzelberg, von Klöden, von Schwechten???) im Ort Klein Schwechten erhielten die
größeren 4-Hufen-Höfe. Der wohl wichtigsten Hof war sicherlich der direkt neben
der Kirche, der sich als Gutshof bis ins 20. Jh. erhalten hat. Die wichtigsten
Lokatoren für beide Dörfer, die Mitglieder einer Familie brachten
eventuell den Namen „Schwechten“ mit oder übernahmen ihn
hier von der Siedlung und siedelten sich mit drei 4-Hufen-Höfen in Groß
Schwechten an (darum gab es hier später so viele v. Schwechten, die im
Landbuch Karls IV. erwähnt wurden: 3 Höfe mit je 4 Hufen, die aber zur
Bewirtschaftung an andere Bauern vergeben waren). Wahrscheinlich
hatten die vorherigen Streusiedlungen/Einzelgehöfte keinen Namen und man hat
einfacherweise für Klein Schwechten den Namen von Groß Schwechten entliehen. Von der
Familie von Schwechten zogen einzelne Mitglieder dann im Rahmen
der Ostkolonisierung (nach dem Wendenkreuzzug 1147 und später) unter Albrecht
dem Bären und seinen Nachfolgern in Richtung Pommern, Havelland etc.. Daher
die häufigeren Namensnennungen v. Schwechten
für diese Gegenden. Es könnte sein, dass die Schwechtener Ritter aus Klein
Schwechten wegzogen, im Mannesstamm ausgestorben waren, das Lehensgut (der
Hof) an den Markgrafen fiel und dieser (Ludwig d.R.) ihn an seinen
Gefolgsmann von Lützendorf übergab/verkaufte (Lützendorf hatte einen
eigenen Hof, also Allod). Die möglichen Gründe sind nicht bekannt.
Denkbar sind finanzielle Gründe oder auch militärischer Erfolg den Ludwig
d.R. war ja in etliche Auseinandersetzungen verwickelt und ständig in
Geldnot. Aber auch
ein anderer Weg ist gut denkbar,
nämlich dass in der Nachbarschaft des älteren überwiegend slawisch besiedelten
Klein Schwechten, die germanische Siedlung Groß Schwechten gegründet wurde
wobei der neuere, germanische Name übernommen wurde und erhalten geblieben
ist. Es ist anzunehmen, dass dabei die Fluren neu vermessen und zugeschnitten
wurden, wobei auch die Bebauung nach einem Plan erfolgte. Wenn es
stimmt dass die Kirche in Klein Schwechten aus der ersten Hälfte des 12.
Jahrhunderts stammt und die in Groß Schwechten aus der 2. Hälfte, dann Das ist aber
ausschließlich Spekulation und nicht urkundlich belegt. |
|
In den wendischen Siedlungen wurden oft Junker oder Ritter
(z.B. als Lokatoren)angesetzt, die natürlich „ein Auge“ auf die Wenden haben
sollten. Dabei war ein Rittergut nun keinesfalls eine steinerne befestigte
Burganlage sondern in der Regel allenfalls ein ein- bis zweigeschossiger
umzäunter Fachwerkbau (Zaunjunker war eine gebräuchliche Bezeichnung).
Evtl. war es ja auch angebracht aus Gründen der besseren Verteidigung
zusammenzurücken. In alter Zeit soll in Klein Schwechten ein Grabensystem
rund um Kirche und Gut bestanden haben. Dazu gibt eine Flurkarte von 1835
(unten) nähere Informationen. Mit Sicherheit war die Lage des Ritterhofs auch
aus Sicherheitsgründen so gewählt, denn der Übergang über die Uchte bei
Goldbeck (noch ohne Brücke) war ein natürlicher Verkehrsweg. Damals war die
Wegführung noch vom Gut aus überwiegend geradeaus und nicht so wie heute,
s.u.. Im Ort selbst übte ein Schulze die lokale Autorität aus. Im
Jahr 1482 ist Claus Geyster als Schulze erwähnt. In den
Kontributionslisten von 1684 wird ein Erbschulze (Fabian
Erxleben) genannt, der einen 3-Hufen-Hof hatte. In dieser Größe gab es
1684 noch einen weiteren Hof, ansonsten hatten die Ackerleute 2 Hufen zur
Bewirtschaftung. Die Kossatenhöfe waren nur eine halbe Hufe groß. Da 1684 ein
Ackerhof wüst war, gab es elf Ackerhöfe. Evtl. waren es um diese Zeit einmal die oft ausgewiesenen 12
Ackerhöfe mit je 2 Hufen, insgesamt 24 Hufen für die Ackerleute. Dazu kamen
24 Kossaten, die wahrscheinlich jeweils eine halbe Hufe hatten. Das Gut war
mit 17 Hufen angegeben (dabei ist nicht klar ob der wüste Ackerhof mit 2
Hufen dem Gut zugeschlagen war und in dieser Summe enthalten war). Wenn man unterstellt, dass sich diese Strukturen wohl schon lange
erhalten haben, ist eine systematische Anlage des Dorfes sehr wahrscheinlich.
Systematisch bedeutet hier, dass die Flur eingeteilt wurde in Felder (i.d.R.
3 Felder, danach auch die Dreifelderwirtschaft) und danach der Anteil der
einzelnen Höfe auftgeteilt wurde. Die Größe der Hufen war innerhalb eines
Ortes gleich, schwankte allerdings oft sehr unterschiedlich je nach Gebiet
zwischen zehn und 15 Hektar. Die Hufen bezeichneten nicht nur das reine
Ackerland sondern waren auch eine Meßeinheit für die Ertragskraft. An Wiesen
und Weiden und am Wald bestand gemeinschaftliches Eigentum. |
|
|
|
Ansicht von 1835, rund um
Kirche und Gut sind auch die Gräben und Teiche zu erkennen, die zur
Verteidigung angelegt waren. Auffällig ist auch die noch heute bestehende
Grundform rund um den dreieckigen Dorfplatz, allerdings außerhalb des
Grabensystems rund ums Gut. |
|
|
Alte Strassenführung über
die Uchte, an der sich lange Zeit bis ins 20. Jahrh. hinein eine Furt befand. |
|
|
Flur zwischen Klein und Groß
Schwechten |
|
Woher kommt der Name
Schwechten und wer trägt ihn heute noch Nach
allem was man
bisher in Erfahrung gebracht hat, ist der Ursprung des Namens also nicht
wendisch sondern deutsch. Ziemlich sicher wird aber auch von verschiedenen
Autoren immer wieder behauptet, dass der Ort ursprünglich wendischen
Ursprungs ist. Allerdings ohne vertiefende Hinweise auf diese Erkenntnis,
außer dem „Klein“. Der Name des Ortes Klein Schwechten hat im Laufe der Zeit
verschiedene Schreibweisen gehabt. So sind bekannt Lütkeschwechten, parna
Schwechten (1377) lutken swechten (1394), Suecten, swecten oder auch minori
swechten (1361) als lateinische Schreibweise,s. oben). Im Registerband es Codex Diplomatcus
Brandenburgensis von Riedel sind etliche Schreibweisen zu Schwechten
aufgeführt:
Siebmachers Wappenbuch „Abgestorbener Preussischer
Adel“ |
|
Manche meinen, der Name stehe in irgendeinem
Zusammenhang mit 'Schadewachten' einem Dorf, das heute zu
Stendal gehört. Dafür habe ich keinen Beleg gefunden. Dr. Fritz Milkowski, Potsdam, geboren in Groß Schwechten, beschäftigt sich in einem Aufsatz (1984, Studien zur Geschichte meines Heimatdorfes Groß Schwechten) mit dem Namen Schwechten:, s.u. Dr. Fritz Milkowski, Ich bin der Überzeugung, dass
sich der Ortsname Schwechten aus dem altdeutschen 'schweiga' (Weide) in
Verbindung mit ihrer Lagebezeichnung 'zur Uchten' entwickelt hat; denn die Ortsnamenforschung
beweist, dass seit ältester Zeit in vielen Sprachen ein enger Zusammenhang
zwischen Orts- und Gewässernamen besteht. Und wenn das richtig ist, dann
dürfen wir annehmen, dass die erste Besiedelung der Landschaft um Gross
Schwechten (Überflutungsgebiet der Elbe, der Uchte und deren Zuflüsse) durch
Semnonen bis in die Zeit um 800 oder noch früher zurückreicht (mit der
Opferstätte Krip als Ausgangspunkt? so wie später Burgen und Kirchen Zentren
geworden sind). Wenn
es ferner richtig ist, dass die nähere Kennzeichnung eines Ortes mit 'Groß'
auf germanischen Ursprung schließen lässt, dann kann man folgern, da das
Stammwort Schwechten eindeutig nicht slawischen Ursprungs ist, dass sich die
dananch über die Altmark hinaus nach Westen vorschiebenden wendischen Siedler
in der Nachbarschaft vom älteren Schwechten niedergelassen und durch den
Zusatz Klein (lutke) ihre Familien- und Stammesbindungen zum Ausdruck
gebracht haben und die alten Schwechtener begünstigt durch das Dorfwachstum
sich zum Groß Schwechten (grote swechten etc.) mauserten. Nach den blutigen
Kämpfen gegen die brutale Unterdrückung durch Dietrich, den ersten Markgrafen
der Altmark, hatten sich die Wenden Ausgang des 10. Jahrhundert für 150 Jahre
ihre Unabhängigkeit zurückerobert. Als vom 12. Jahrhundert an die deutsche
Feudalherrschaft wieder nach Osten vordrang und feste Herrensitze gründete
ist vermutlich auch das Rittergut Klein Schwechten gegründet worden. Für die
Wahl dieses Ortes könnte ausschlaggebend gewesen sein, dass die verbliebenen
slawischen Siedler leichter zu Hörigen und Leibeigenen gezwungen werden
konnten als die unter den Wenden sesshaft gebliebenen germanischen Siedler im
benachbarten Groß Schwechten, denen eine relative Selbständigkeit (und daraus
folgend: Sattheit, Anpassungsgeneigtheit?) belassen blieb. Nachfolgend sind weitere mögliche sprachliche
Ableitungen/Ursprünge einmal aufgeführt. Dabei hat besonders das Wörterbuch
der Gebrüder Grimm gute Dienste geleistet, ansonsten ist es
Internet-Recherche.
Indogermanisches etymologisches
Woerterbuch [Pokorny] : Sweiga Lexikon des
Althochdeutschen (8. Jahrhundert) Im 8. Jahrhundert kam der Ort Schweich in den Besitz des Klosters Prüm. Der Frankenkönig Pippin hatte eine Enkelin der Bertrada, die das Prümer-Kloster gegründet hatte, geheiratet und dieser im Jahre 762 unter anderem die Gebiete um Schweich und Mehring geschenkt. In diesen Schenkungsurkunden wurde der Name Schweich zum ersten Mal erwähnt. Die älteste Namensform ist Soiacum. Daraus wurden Sueyge, Scueiche und Suische. Für den Namen gibt es mehrere Erklärungen. Er wird von manchen Historikern auf den Personennamen Sogius oder Socius, von anderen jedoch auf das althochdeutsche Wort für Viehhof "Sweiga" zurückgeführt. Andere leiten ihn vom lateinischen Sextus, der Sechste ab, ähnlich wie bei Quint oder Detzem. Wirklich interessant ist, dass der
Ort Schweich eine Schaufel im Wappen hat. Schwechten hat
drei Schaufeln. Hier sollte noch recherchiert werden ob es da eine Querverbindung
gibt. Interessant ist u.U. auch eine mögliche Verbindung
zu Schweckhausen in Westfalen, das in anderer Schreibweise auch
Schwechthausen geheißen haben soll. Eine Untersuchung in Richtung auf den holländischen Sprachkreis und auch auf Westfalen halte ich ebenfalls für notwendig. |
Personennamen „Schwechten“
Fridericus
de Swechtinc pincerna noster (unser Schenk) in einer Urkunde von
Graf Heinrich von Ascharien genannt, ausgestellt auf Schloß Bernburg (1229)
Wenn mit Swechtinc Schwechten gemeint ist,
so wie im Registerband des CDA erläutert, bedeutet dies, dass schon vor den
Lützendorfern (ca. 1351) das Schenkenamt mit Schwechten verbunden war.
|
|
Franz Heinrich Schwechten Bekanntester Träger aus
jüngerer Zeit ist sicherlich der Baumeister Franz Heinrich
Schwechten, der die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin, den
Anhalter Bahnhof sowie diverse Industriebauten gebaut hat. Dieser war
allerdings ein gebürtiger Rheinländer aus Köln. Aber wer weiß wie das
zustande gekommen ist. Franz Heinrich Schwechten (* 12. August 1841 in
Köln; † 11. August 1924 in Berlin) war ein deutscher Architekt des
Historismus. Auch heute (2004) ist der Name nicht sehr verbreitet, obwohl es
auch in den USA und in Südafrika Menschen mit dem Namen Schwechten gibt
|
|
In Berlin lebte weiterhin Georg Schwechten
als Pianofabrikant |
Aus der Klavierfabrik von Georg Schwechten, Berlin |
|
Sch. übernahm 1853 die von seinem älteren
Bruder Heinrich Schwechten (1812–1871) 1841 in der Kochstraße
11 begründete Werkstatt für Tafelklaviere und gründete mit seinem jüngeren Bruder
Wilhelm Schwechten (um 1833–1900) im Jahr 1853 die Firma G. Schwechten.
1861 ließ er eine Fabrik in der Kochstraße 60 bauen und erwarb danach auch
die Nachbargrundstücke. Die Klaviere der Firma erlangten bald einen großen
Ruf. Sch. machte sich vor allem um die Entwicklung von Pianinos
verdient. Nach seinem Tod wurde das Stammhaus von seiner Tochter Clara
Fiebelkorn geführt, die für die Firma das Schwechtenhaus erbauen
ließ Das fünfgeschossige Gebäude entstand
1914 nach Plänen von Wilhelm Peters. Friedrich Blume gestaltete die
Fassade.Die Fassaden sind mit Kalkstein, im Hof mit weißen Klinkern
verkleidet. Auf dem Grundstück befand sich bereits davor die Pianofabrik Georg
Schwechtens. Clara Fiebelkorn gab den Bau für die Pianofortefabrik Georg
Schwechten in Auftrag. Zudem wurden Gewerbeflächen vermietet, u. a. ab 1914
an die Berliner Buchbinderei Wübben & Co, die Deutsche Dunlop Gummi AG
sowie an Ruprecht und Co. – China- und Japanwaren. 1937 gehörte das Gebäude
der Continental Büromaschinen GmbH und ab 1938 den Wanderer Werken, einer
Aktiengesellschaft, die Werkzeuge und Werkzeugmaschinen herstellte. Am
Eingang verweist eine Tafel mit der Inschrift "Haus der Wandererwerke"
darauf. 1990 befand sich hier die Bekleidungsfirma Hensel & Mortensen.
Heute nutzen u. a. Rechtsanwälte, Architekten und die Galerie Ascan Crone aus
Hamburg das denkmalgeschützte Haus. Wilhelms Söhne Friedrich und Wilhelm
Schwechten (1880–1954)
Schwechten. gründeten 1910 die Pianofabrik Schwechten & Boes, ab 1911 Gebr. Schwechten, ab 1912 Friedrich Schwechten (Sitz Wilhelmstraße
118, Buchgewerbehaus Lüderitz & Bauer).
Der Architekturzeichner und Kupferstecher Friedrich Wilhelm Schwechten wurde 1796 in Berlin geboren. 1879 starb er in Meißen. Im Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt gab es von
1927-1935 sowie von 1945-1950 einen Geschäftsfüher mit Namen Hasso
Schwechten. |
|
|
Alte Namen im Ort aus
den ältesten Unterlagen Zu den Namen, die zuerst in Zusammenhang
mit Eigentum in Klein Schwechten genannt werden, gehören die von Vinzelberg
(als Vasall bezeichnet) , von Klöden und Peter Schenk von
Lützendorf (als Ratgeber des Markgrafen bezeichnet), im Landbuch v. 1375.
Bei Klöden und Schenk steht: „bewirtschaftet selbst.“ Hans von Klöden verkaufte schon 1383
seine Besitzungen in Klein Schwechten an Claus von Vinzelberg. Die von
Vinzelberg waren in der Altmark umfangreich begütert. Friedrich von Vinzelberg aus Stendal wird noch in
den Visitationsabschieden von 1541 als Collator für verschiedene
Einkünfte der Kirche genannt. Die ersten Hinweise auf einen v. Vinzelberg in
der Altmark sind schon vom Beginn des 14. Jahrhunderts (1306). Die Familie
war weit verzweigt auch nach Brandenburg hinein. Sie waren begütert u.a.
Benedikt v. Vintzelberg, auf Rochow (1584) Georg v. Vintzelberg, auf
Wollenrade (1610) , Benedict v. Vintzelberg, auf Rochow (1529) , Adam v.
Vintzelberg, auf Garchow (1645) , Hans v. Vintzelberg, auf Rochow (1596), Diese drei eingangs genannten Familien
besaßen jeweils einen Hof von 4 Hufen (+ 2 Hufen Eigengut v. Lützendorf). Es
könnte sein, dass diese drei Höfe die ursprünglichen Lokatorenhöfe waren aus
der Gründungszeit des Ortes (s. Spekulation oben). Die von Vinzelberg und von
Klöden waren schon länger in der Altmark ansässig, während die v. Lützendorf
erst um 1350 hierher kamen. Auch das Domstift St. Nikolai in
Stendal hatte Einkünfte in Klein Schwechten. Es gibt keinen Hinweis
darauf dass diese Einkünfte zur der Erstausstattung des Domstifts stammen,
aus der Gründungsphase des Stiftes im Jahr 1188 durch Graf Heinrich von
Gardelegen, eines Brudes des Markgrafen Otto II, ebenso hatten Einkünfte die
Kirche in Eichstedt und die von der Schulenburg. Als Gutsherren am längsten
haben sich dann die Schenken von Lützendorf in Klein Schwechten gehalten. Der
Name Vintzelberg als Kossat ist allerdings noch in den
Kontributionslisten von 1684/85 in Klein Schwechten aufgeführt und ist ja
immer noch in der Gegend lebendig. Fortsetzug
folgt>>>>>>>>>>>> |